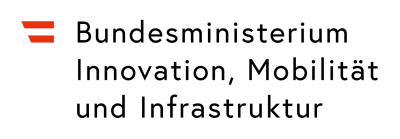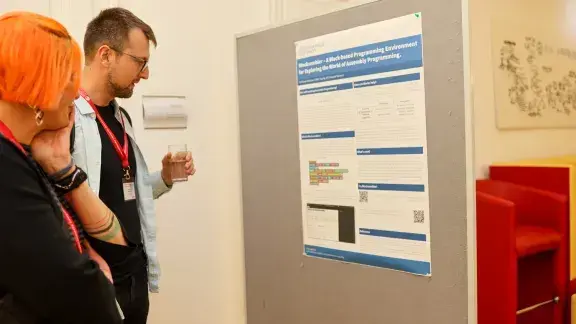Symposium I: Ein Vormittag voller Impulse – Computer Science in Higher Education
Am 13. Mai 2025 startete das internationale Symposium der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) gemeinsam mit CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) mit einem dichten und inspirierenden Programm zum Thema „Computer Science in Higher Education“. Renommierte Expert*innen, politische Entscheidungsträger*innen und Pädagog*innen aus ganz Europa trafen sich im OCG-Foyer in der Wiener Innenstadt, um die Zukunft der Informatikbildung zu diskutieren – mit Fokus auf Hochschulen, Chancengleichheit und digitalen Kompetenzen.
Willkommen & Keynote
Eröffnet wurde der Vormittag von Jakub Christoph (CEPIS), Ronald Bieber (OCG) und Alexander Prosser (WU Wien/OCG). Gleich im Anschluss beleuchtete Clara Neppel (IEEE Europe) in ihrer Keynote From sandboxes to the real world, warum es entscheidend ist, wie wir die digitale Welt gestalten – und welche Verantwortung damit für die Bildung verbunden ist.
Sie betonte, dass die zunehmende Autonomie und Komplexität digitaler Systeme, etwa durch neue KI-Agenten, auch neue Risiken für Sicherheit, Datenschutz, Klima und Menschenrechte mit sich bringen. Während Technologien wie Drohnenschwärme zeigen, wie sich KI mit sicherer Steuerung verbinden lässt, fehlen in der Industrie oft noch Standards für Energieeffizienz oder ethische Leitlinien. Neppel forderte deshalb neue Erfolgskriterien für die digitale Welt, die neben technischer Leistung auch soziale und ökologische Auswirkungen einbeziehen sowie eine digitale Kultur, in der kritisches Denken und Folgenabschätzung fest verankert sind.

Panel: Student-Centered Education – Mental Health und Accessibility
Unter der Moderation von Maria Geir (Octenticity) wurde intensiv darüber diskutiert, wie psychische Gesundheit, digitale Kompetenzen und Inklusion in der Bildung zusammenhängen.

Edith Hülber (Bildungsdirektion Wien) betonte gemeinsam mit Henrietta Loos (Schulleiterin der inklusiven Schule Zinckgasse, Wien), dass Inklusion auch Lehrpersonen mit Behinderung miteinschließen muss. Viele Kinder in Wien haben keinen Zugang zu Geräten oder Internet – Schulen kompensieren das, indem sie Ausstattung zur Verfügung stellen. Sie hob auch digitale Avatare hervor, die chronisch kranken Schüler*innen die Integration in den Unterricht ermöglichen.
Klaus Höckner (Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs) kritisierte, dass ICT oft Exklusion statt Inklusion bedeutet – insbesondere, da 75 % der Behinderungen nicht sichtbar sind. Barrierefreiheit müsse von Anfang an mitgedacht werden. Fehlende digitale und inklusive Kompetenzen bei Lehrkräften führen dazu, dass Talente verloren gehen. „Wir müssen inklusive Schulen schaffen!“
Gerd Krizek (IT:U) ergänzte, dass Bildung sich an den Bedürfnissen der Lernenden orientieren müsse und nicht an den Tools. Digitale und physische Barrierefreiheit sollen in allen Maßnahmen mitgedacht werden. Er warnte vor dem Mythos der „Digital Natives“: Viele junge Menschen besitzen Geräte, wissen aber nicht, wie sie diese sinnvoll nutzen. „Wir glauben, sie können es – aber es fehlt ihnen an digitaler Kompetenz.“

Zentrale Botschaften des Panels:
- Technologie darf nicht zum Gatekeeper werden.
- Inklusion ist nicht nur moralisch richtig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.
- Lehrkräfte brauchen gezielte Aus- und Weiterbildung zu Barrierefreiheit und digitaler Kompetenz.
- Es braucht mehr Bewusstsein, politischen Willen und verbindliche Standards – wie etwa ICDL-Zertifikate – für echte digitale Teilhabe.
Best Practices in interdisziplinärer Lehre
Martina Gaisch (FH Oberösterreich) stellte eindrucksvoll dar, warum gerade der IT-Bereich so viele junge Frauen verliert – trotz hoher weiblicher Beteiligung in Mathematik und Technik. Die Gründe reichen von einem „Confidence Gap“ über abschreckende Stereotype bis hin zu fehlender Repräsentation und mangelndem Zugehörigkeitsgefühl.
Was abschreckt:
- IT gilt bei Mädchen als kompliziert, langweilig oder „nicht sozial“.
- Die Gesellschaft vermittelt noch immer, dass IT „nichts für sie“ sei.
- Mathematik wird oft mit Angst und Überforderung assoziiert.
Was fehlt:
- Positive Assoziationen: Kreativität, Usability, Innovation, gesellschaftlicher Impact
- Vorbilder, die greifbar sind – nicht nur „Rocket Scientists“
Was hilft:
- Sichtbarkeit einer kritischen Masse („Wenn 30 % Mädchen dabei sind, komme ich mit“)
- Sprache, die inspiriert – „Creative Coding“ statt „Web Engineering“
- Interdisziplinarität & sinnstiftendes Lernen: Studierende als „Übersetzer*innen“ zwischen Code und Gesellschaft
- Mut zur Veränderung und die Fähigkeit, alte Denkmuster zu verlernen
- Male Allies, die Türen öffnen und ermutigen: „Give it a go!“
Ihr eindringlicher Appell: Wir verlieren 50 % der Mädchen bereits in der Schule. Es ist Zeit, IT neu zu erzählen – als kreatives, relevantes und inklusives Feld.

Diversität jenseits von Buzzwords
Verena Fuchsberger-Staufer (Uni Salzburg) analysierte Barrieren für Frauen in Maker Spaces: Lärm, Mansplaining, Rollenbilder und unklare Zugehörigkeit halten viele fern. Ihr Appell: Räume müssen echte Inklusion leben – systematisch, sichtbar und sensibel.
Basierend auf Studien mit AIT und HappyLab identifizierte sie zentrale Barrieren, die insbesondere Frauen vor Maker Spaces abschrecken:
- Das Wort Engineering verunsichert
- Lärm, fehlende Kompetenzzuschreibung durch männliche Anwesende in Maker Spaces
- Der Wunsch nach autonomem Arbeiten wird oft durch soziale Dynamiken behindert.
Lösungsansätze:
- Klare Signale wie Buttons mit „Don’t approach me“ und "I am open for suggestions"
- Räume müssen echte Inklusion leben, nicht nur behaupten.
- Es braucht systemischen Wandel, z. B. gezielte Programme wie Female Worker Month“.
Ein zentrales Problem: Viele Frauen bezeichnen sich selbst nicht als „Maker“ – die Sprache spielt eine entscheidende Rolle.
Ihr Appell: Jede*r von uns kann jemanden ins digitale Berufsfeld bringen. Sichtbarkeit und Anerkennung müssen aktiv gestaltet werden.

Frauenförderung in der Technik – Rückblick & Ausblick
Gerti Kappel (TU Wien) gab einen tiefen Einblick in mehr als ein Jahrzehnt erfolgreicher Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Informatik. Mit der Erfolgsformel Attract – Retrain – Promote – Sensitize wurde der Frauenanteil unter Professor*innen an der TU Wien spürbar erhöht.
Erfolgsformel: Attract – Retrain – Promote – Sensitize
- Attract: Workshops für Schüler*innen an der TU, Sommerschulen, aktive Ansprache ab jungem Alter (z. B. eduLAB)
- Retrain: Motivation an Konferenzen teilzunehmen, spezifische Stipendien, Quoten in Doktoratskollegs
- Promote: Aktive Motivation von Studierenden, bei Konferenzen zu sprechen, PhD zu machen, Assistant Professorships anzunehmen; Female Excellence Programme bereitstellen
- Sensitize: Gender Awareness Workshops für Universtitätsmitarbeiter*innen, Kompetenzanforderung „Gender“ bei Berufungen
Lessons learned:
- Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. traditionelle Rollenbilder) bleiben eine zentrale Hürde.
- Frauen brauchen keine „Hilfe“, sondern Anerkennung und gezielte Förderung.
- Sprache, Sichtbarkeit und Ressourcen machen den Unterschied – Role Models wie Christiane Floyd sind essenziell.
- Kinderbetreuungseinrichtungen, wie der TU-Kindergarten, sind wichtig für Vereinbarkeit.
- Informatik muss Pflichtfach in der Oberstufe werden – Technikverständnis ist Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe.

Gleichstellung beginnt im Kindergarten
Mit einem sehr persönlichen Beitrag rundete Maria Rauch-Kallat, Bundesministerin a.D., den Vormittag ab. Sie plädierte für geschlechtsneutrale Bildung ab dem frühesten Alter – und warnte davor, dass viele Mädchen Berufe nach sozialen Aspekten wählen, ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bedenken. „Ich hatte gehofft, meine Töchter würden Gleichstellung erleben. Heute sehe ich: Nicht einmal meine Enkelin wird es.“
Mentoring-Programme wie Club Alpha zeigen, wie gezielte Förderung wirken kann – wenn wir nur bereit sind, voneinander zu lernen. Ihr Appell: „Schaut auf die Best-Practice-Beispiele – und setzt sie um.“

Mentoring als ein Weg zur Veränderung
Zum Abschluss präsentierte Alexander Prosser (WU Wien/OCG) das neue OCG Mentoring-Programm für Informatikerinnen im Masterstudium und im Job, das gezielt junge Talente fördern und vernetzen soll. Geplant ist ein Netzwerk aus Mentor*innen aus Österreich aus Industrie und Wissenschaft. Die Mentees werden einen Bewerbungsprozess durchlaufen und dann ein Jahr lang begleitet. Ein kleiner Schritt mit potenziell großer Wirkung – ganz im Sinne des Symposiums.

Fazit des Vormittags:
Je früher mit informatischer Bildung begonnen wird, desto besser. Informatik hat ein eher negatives Image bei Mädchen, hier können andere Terminologien helfen.
Alle Fotos finden Sie auf unserem Flickr Account.
Das Symposium wurde unterstützt durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.