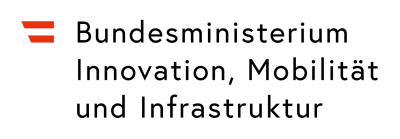Symposium III: Computing – Empowerment in Action
Am zweiten Tag des Symposiums Computer Science in Education drehte sich alles um Computing und Empowerment. Der Tag begann mit einer Führung durch das eduLAB der TU Wien Informatics, wo Rene Röpke, Lukas Lehner und Martina Landman innovative Lernumgebungen und Konzepte zur Förderung informatischer Kompetenzen vorstellten.
Zurück in der OCG-Zentrale in der Wollzeile eröffnete OCG Generalsekretär Ronald Bieber offiziell das Programm. Es folgte eine inspirierende Reihe an Keynotes:

EU braucht 20 Millionen IT-Fachkräfte

Leonie Bultynck (Europäische Kommission):
Bultynck von der European Commission expert group on high-quality informatics education zeichnete ein klares Bild der Herausforderungen im Bereich der digitalen Bildung in Europa. Obwohl 90 % aller Jobs heute digitale Grundkompetenzen erfordern, verfügen nur 56 % der EU-Bürger*innen über diese. Es fehlen nicht nur 20 Millionen IT-Fachkräfte, sondern insbesondere qualifizierte Informatiklehrkräfte. Die EU-Kommission arbeitet mit einer Expert*innengruppe an einer einheitlichen Terminologiefür Informatikbildung, um Lehrkräfte zu unterstützen. Ein Leitfaden für hochwertige Informatikbildung soll bis Jahresende in allen EU-Sprachen erscheinen. Länder wie Dänemark oder Finnland seien hier bereits etwas weiter, aber insgesamt sieht sie Europa noch im Rückstand. Projekte wie Girls Go Circular zeigen, wie Empowerment konkret aussehen kann.
Wissen ist Macht

Tobias Kohn (Karlsruher Institut für Techologie):
In seinem Vortrag hinterfragte Kohn kritisch die Begriffe rund um Künstliche Intelligenz. Vieles sei Marketing, Glaube und Mythos, doch echte Befähigung entstehe durch Verstehen, Reflektieren und aktives Handeln. KI solle nicht als Blackbox akzeptiert werden, vielmehr brauche es Bildung, die junge Menschen in die Lage versetzt, Technik zu hinterfragen und selbstbestimmt zu nutzen. Besonders betonte er die gesellschaftliche Verantwortung von Informatiker*innen: Technik dürfe nicht nur dem Profit folgen, sondern müsse echte Probleme lösen.
Informatik so wichtig wie Lesen und Schreiben

Dennis Komm (ETH Zürich):
Er präsentierte ein spiralförmiges Curriculum für Programmieren über alle Schulstufen hinweg. In der Schweiz ist Informatik ab dem Kindergarten verpflichtend. Komm argumentierte, dass die Schule nicht dazu da sei, Big-Tech-Interessen zu bedienen, sondern Kinder zur Selbstständigkeit, zum Denken und Problemlösen zu befähigen. Auch wenn Maschinen programmieren können, bleibe es wichtig zu verstehen, wie die digitale Welt funktioniert, und zwar ähnlich wie Lesen und Schreiben trotz Textverarbeitung unerlässlich ist.
Paneldiskussion: Hindernisse bei der Vermittlung von Informatikbildung
Unter der Moderation von Corinna Hörmann (JKU Linz) diskutierten Vertreter*innen aus Wissenschaft und Bildung über Hindernisse in der Informatikbildung:

- Corinna Mößlacher (PH Kärnten) betonte die negativen Assoziationen vieler Schülerinnen mit Informatik und den Bedarf ihnen zu zeigen, was Informatik eigentlich ausmacht.
- Rene Schwarzinger (ARGE Informatik) hob hervor, dass die besten Stunden jene sind, in denen Schüler*innen selbst aktiv programmieren können.
- Bernhard Standl (PH Karlsruhe) sieht im „Spirit of Computer Science“ den Kern digitaler Bildung, also darin, Probleme strukturiert zu lösen.
- Leonie Bultynck warnte vor Begriffswirrwarr: Informatik, Computer Science, digitale Kompetenzen, Medienbildung – es brauche klare Definitionen und einheitliche Begriffe.
Die Diskussion machte deutlich: Mythen wie „Computer Science ist nur für Jungs“ oder „digitale Tools bedienen = Computer Science“ müssen aufgelöst werden. Gleichzeitig kann und soll nicht jede Lehrperson zur Informatikexpertin werden; hier sind gezielte, realistische Fortbildungskonzepte gefragt.
Abschluss: Young Researchers – Empowerment in Practice
Den Abschluss bildeten Kurzpräsentationen junger Forscher*innen, moderiert von Martin Kandlhofer (OCG). In einem 10-minütigen Pitch-Block präsentierten Studierende ihre Projekte, gefolgt von einer Postersession mit Flying Buffet, bei der sich lebendige Gespräche zwischen Forschenden, Lehrenden und Gästen entwickelten – ein starker Beweis für das Potenzial des Nachwuchses.



Diese zweite Konferenzhälfte zeigte eindrucksvoll: Informatikbildung ist keine technische Nebensache, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe, die nur im Zusammenspiel von Politik, Bildungssystem und Zivilgesellschaft gelingen kann. Mehr zum Symposium finden Sie im nächsten OCG Journal. Alle Fotos finden Sie auf unserem Flickr Account.
Das Symposium wurde unterstützt durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.