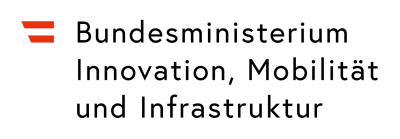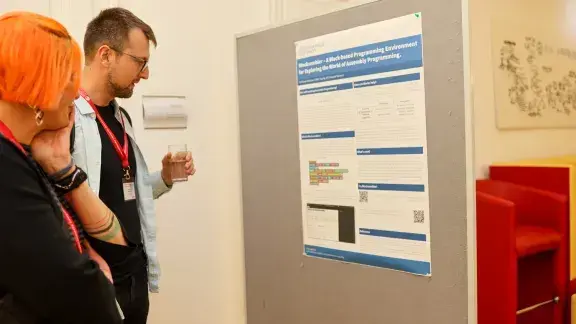Symposium II: Computing as a Foundation for Empowered Citizens
Beim Symposium Computer Science in Education: By Humans, for Humans das von der OCG in Kooperation mit CEPIS organisiert wurde, diskutierten am 13. und 14. Mai 2025 Fachleute aus der Wissenschaft zu drei Schwerpunkten (siehe Computer Science in Higher Education).
Am Nachmittag drehte sich alles um die Frage, wie Informatikbildung zur digitalen Mündigkeit beitragen kann – unter dem Titel "Computing as a Foundation for Empowered Citizens".
Best Practices in Curricula Design – the International View

Irene Bell (Stranmillis University College) aus Nordirland lieferte dem ersten Input zum Thema Best Practices in Curricula Design – the International View. Sie zeigte am Beispiel des Vereinigten Königreichs, wie Informatik als Pflichtfach ab dem fünften Lebensjahr verankert ist. Das Curriculum fördert den Weg vom „Digital Citizen“ zum „Digital Maker“ mit einem klaren Fokus auf fächerübergreifendes Lernen. Gleichzeitig wies sie auf Herausforderungen hin: Curricula ändern sich oft, viele Lehrkräfte fühlen sich unsicher und der Mangel an qualifiziertem Personal bremst die Entwicklung.

Ivan Kalaš aus der Slowakei stellte das vielfach erprobte Programm Informatics with Emil vor. Es setzt auf kreatives, forschendes Lernen im Volksschulalter. Statt schneller Bewertungen steht Reflexion im Mittelpunkt: Kinder sollen entdecken, Lehrkräfte begleiten. Ziel ist ein emotional ansprechender Informatikunterricht, der Brücken zu anderen Fächern schlägt.

Nataša Grgurina aus den Niederlanden berichtete über die Entwicklung eines neuen Rahmenplans zur digitalen Grundbildung. Der Fokus liegt auf konzeptionellen, zeitlosen Inhalten statt auf konkreten Tools. Qualität zeigt sich hier in Chancengleichheit, Anschlussfähigkeit und zukunftsfester Gestaltung – auch wenn Lehrkräftemangel ein großes Hindernis bleibt.

Michael E. Caspersen aus Dänemark schließlich machte deutlich: Informatik ist eine Grundkompetenz des 21. Jahrhunderts, genauso wichtig wie Lesen oder Schreiben. Er forderte eine Bildung, die technisches Wissen mit gesellschaftlicher Reflexion verbindet. Mit Konzepten wie DORIT (Do Your Own Research in Technology) soll technologische Mündigkeit gefördert werden, und zwar nicht nur im Informatikunterricht, sondern in allen Fächern.
Der österreichische Weg
Die Paneldiskussion „The Austrian view – computer science and its contribution to empowered citizens“ betonte die Bedeutung der Informatik für mündige Bürger*innen und diskutierte aktuelle Herausforderungen im österreichischen Bildungssystem. Corinna Hörmann, JKU Linz, moderierte die Diskussion.

Früh anfangen & Interesse fördern
Rene Röpke (TU Wien) betonte, dass Kinder gesellschaftliche Veränderungen spüren und Interesse zeigen, dieses müsse gefördert werden. Informatik solle nicht erst in der 9. Schulstufe beginnen, sondern früher und eigenständig gelehrt werden.
Herausforderung für Lehrkräfte
Corinna Mößlacher (PH Kärnten) thematisierte, dass Informatik oft nur in wenigen Stunden behandelt wird, während Lehrer*innen anderer Fächer das Thema Informatik komplett ausklammern. Ihr Wunsch wäre, dass Forschungsergebnisse in die Klassenzimmer zurückfließen sollten, und zwar mit Fokus auf die Umsetzung durch Lehrpersonen.
Mehr als nur Programmieren
Roderick Bloem (TU Graz) wies auf den Wandel der Welt hin. Informatik sollte gleichwertig mit anderen Schulfächern behandelt werden. Markus Vesely (A-Trust) ergänzte, dass technische Kompetenz für alle notwendig sei, etwa für E-Government. Informatik sei mehr als nur Coding; sie stärke Selbstvertrauen. Kostenlose, leicht zugängliche Basiskurse und deren Vorteile besser zu kommunizieren, wäre ein Weg, Menschen außerhalb der Schule zu erreichen.
Insgesamt bestand Einigkeit darüber, dass Informatikbildung ausgebaut, früher angesetzt und praxisnah vermittelt werden muss, um digitale Selbstermächtigung zu ermöglichen.
Quo vadis Bildung in Zeiten der Automatisierung
Im interaktiven Workshop „Strengthening computer science education across Europe – Quo vadis Bildung in Zeiten der Automatisierung“, moderiert von Jakub Christoph (CEPIS), betonte Juraj Hromkovič (ETH Zürich), dass der Zweck von Bildung das eigenständige Denken sei, ein Zitat von Einstein als Leitgedanke. Informatik beschrieb er als verlängerten Arm der Mathematik mit drei zentralen Regeln: (1) Information und Daten – das Speichern von Wissen außerhalb des Gehirns, wie schon vor 3400 v. Chr.; (2) Automatisierung – Prozesse so beschreiben, dass andere sie ausführen können und (3) Technologie – mit historischen Beispielen wie der Rechenmaschine von Leibniz. Informatikunterricht solle Schüler*innen befähigen, die von Menschen geschaffene Welt zu verstehen, zu gestalten und zu steuern, dabei mathematische und sprachliche Grundkompetenzen stärken und technisches Denken in den Schulalltag integrieren.

Wie können wir Computer Kompetenz stärken?
Im Fireside Chat diskutierten Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und Medien, was notwendig ist, um digitale Kompetenzen und Informatikbildung nachhaltig zu stärken.

Gerti Kappel (TU Wien) betonte, dass Informatik kein „Nerd-Fach“ sein dürfe. Strukturiertes und problemlösendes Denken müsse als gesellschaftlich relevante Kompetenz anerkannt werden. Sie forderte Informatik als Pflichtfach, bessere Bezahlung für Lehrkräfte und ein klares politisches Bekenntnis jenseits von Ideologien.
Fernando Suarez-Lorenzo (CCII, Spanien) sprach sich für europaweit abgestimmte Kompetenzrahmen und langfristige Strategien aus. In Spanien mangele es noch am Bewusstsein für die Bedeutung von Informatik. Lehrermangel, fehlende Budgets und unzureichende Visionen seien große Hürden.
Karin Krichmayr (Der Standard) berichtete aus medienperspektive von überforderten Lehrkräften und mangelnder Transparenz über digitale Fähigkeiten von Schüler*innen. Sie forderte lebensnahe Beispiele und Geschichten in der Öffentlichkeit, um das Potenzial von Informatik sichtbar zu machen und sprach sich für spielerische Ansätze wie „eduLAB“ aus.
Martin Bauer (Österreichisches Bildungsministerium) hob hervor, dass digitale Bildung mehr sei als nur Informatik: Digitale Kompetenzen müssten auch in anderen Fächern und Alltagskontexten gestärkt werden.
Michael E. Caspersen (Aarhus University) forderte hochwertige Lehrmaterialien, europäische Kooperation und mehr politischen Mut. Er beklagte eine gewisse politische Trägheit und sieht Wissenschaftler*innen in der Pflicht, den Nutzen von Informatik überzeugend zu kommunizieren.
Der Tenor: Digitale Bildung braucht gemeinsame Strategien, langfristige Investitionen, mehr Sichtbarkeit und entschlossenes Handeln, bevor der internationale Rückstand noch größer wird.
Der Nachmittag zeigte klar: Wer digitale Bildung ernst nimmt, muss früh beginnen, ganzheitlich denken und sowohl Schüler*innen als auch Lehrkräfte stärken.
Alle Fotos finden Sie auf unserem Flickr Account.
Das Symposium wurde unterstützt durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.